Um den hydraulischen Abgleich zu verstehen, hilft es, technische Hintergründe sowie den baulichen Ist-Zustand des Gebäudebestands in Deutschland zu kennen. Mehr als zwei Drittel des Endenergieverbrauchs privater Haushalte entfallen auf die Beheizung der Wohnräume. Im Jahr 2019 lag der Anteil der in privaten Haushalten für Heizung und Warmwasserbereitung genutzten Endenergie am gesamten Energieverbrauch in Deutschland bei gut einem Viertel.
In diesem Bereich liegt ein erhebliches Einsparpotenzial. Laut dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) sind bis zu vier Millionen Heizungsanlagen in Deutschland veraltet und aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs und der damit verbundenen Umweltbelastung dringend sanierungsbedürftig. Jedes Jahr kommen etwa 300.000 Heizungen hinzu, die das Alter von 25 Jahren überschreiten und somit ineffizient arbeiten.
Seit der Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Februar 2002 ist das Niedrigenergiehaus (NEH) zum Standard geworden. Gebäude, die nach dem Stand der Wärmeschutzverordnung von 1995 (WSchV) errichtet wurden, sowie Niedrig- oder Passivenergiehäuser, bieten – vorausgesetzt sie sind sachgemäß ausgeführt – eine solide Grundlage für eine signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs. Aktuell ist das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, der neueste Standard, der die Richtlinien für Sanierungs- und Neubauarbeiten vorgibt.
Energieeinsparungen entlasten sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel.
Ähnlich wie bei einem Auto, bei dem das umweltfreundlichste Fahrzeug dasjenige ist, das nicht fährt und somit keinen Kraftstoff verbraucht, gilt es auch bei Heizungsanlagen in erster Linie, den Energiebedarf zu senken. Dies lässt sich durch eine wirtschaftlich sinnvolle Reduktion der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste, insbesondere im Neubau, erreichen.
Die wahre Herausforderung liegt jedoch in den zahlreichen Bestandsgebäuden. Über 90 % der Wohn- und Nutzflächen entfallen auf Gebäude, die vor dem Inkrafttreten der Wärmeschutzverordnung von 1995 errichtet wurden. Diese älteren Gebäude benötigen über 95 % der Energie, die für die Deckung des Heizbedarfs erforderlich ist.
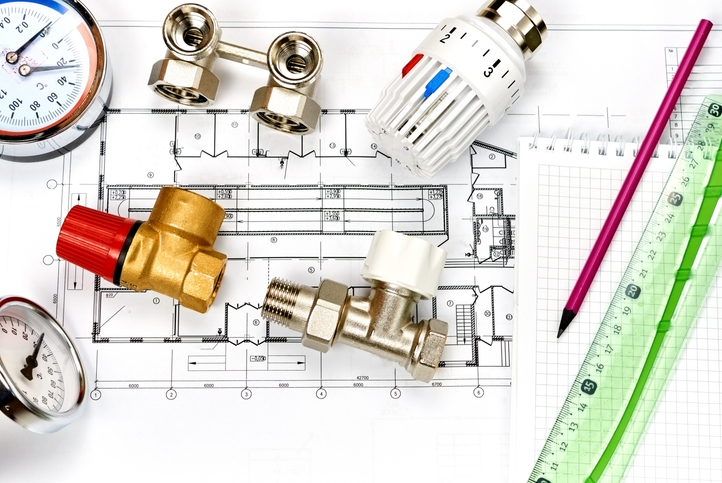
Aber was hat das mit dem hydraulischen Abgleich zu tun?
Sehr viel. Denn die Reduzierung des Heizwärmebedarfs durch Maßnahmen wie verbesserte Wärmedämmung, Wärmeschutzverglasung und Winddichtigkeit ist nur ein Teil der energetischen Optimierung.
Veränderte Randbedingungen, wie etwa ein reduzierter Wärmebedarf oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung, wirken sich direkt auf die Anlagentechnik aus und erfordern eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Bleibt diese Anpassung aus, werden die erwarteten Energieeinsparungen häufig nicht erreicht, was zu Enttäuschung führt.
Auch ohne bauliche Verbesserungen bietet der hydraulische Abgleich von bestehenden Heizungsanlagen ein erhebliches Einsparpotenzial. Dies ist nicht nur theoretisch nachweisbar, sondern wurde auch in zahlreichen Feldversuchen bestätigt und dokumentiert. Zudem ist diese Maßnahme vergleichsweise kostengünstig.
Nachteil: Eine Heizungsanlage ist ein komplexes System mit vielen Variablen und unbekannten Faktoren.
Hier setze ich an: Mein Ziel ist es, das Thema ganzheitlich zu betrachten und praktikable Lösungsansätze aufzuzeigen, die die Umsetzung gewährleisten. Dabei möchte ich die Brücke schlagen zwischen der notwendigen Theorie und der Praxis, ohne die nichts funktioniert.
Die physikalischen Grundlagen sind gut dokumentiert und in zahlreichen Fachpublikationen nachzulesen. Doch es gibt Aspekte, die man einfach wissen muss. Wer die Funktionsweise der einzelnen Komponenten versteht, ist dem Systemdenken – das für mich von entscheidender Bedeutung ist – bereits einen Schritt näher.
Es geht darum:
- Einsparpotenziale zu erkennen
- Produktkenntnisse zu erwerben
- Abhängigkeiten zu verstehen
- Werkzeuge zur Berechnung zu beherrschen.
Diese vier Schritte sind entscheidend für den Erfolg in der Praxis – der Kreis muss sich schließen. Während Einsparpotenziale und Produktkenntnisse relativ einfach vermittelbar sind, gestaltet sich das Systemdenken oft schwieriger. Nicht selten scheitert der hydraulische Abgleich an ungeeigneter, schwer bedienbarer Software.
Es ist daher von großer Bedeutung, ein Gespür für Zahlen, Werte und Größenordnungen zu entwickeln, um durch präzise Berechnungen ein wirtschaftlich sinnvolles und praktikables Ergebnis zu erzielen.
Ist-Zustands Analyse in Heizungsanlagen
In Bestandsgebäuden ist es erst einmal wichtig zu verstehen, um was es sich handelt. Fangen wir erst einmal bei der Zonierung an.
- Wie groß ist das Heizungsrohrnetz? Während diese Frage bei einem Einfamilienhaus sehr überschaubar ist, wird es in größeren Wohngebäuden mit 10, 20 oder 30 Wohneinheiten oder etwa Bürokomplexen schon deutlich komplizierter. Wenn man einen ersten Überblick über das Rohrnetz gewonnen hat, kann man sich weiter in die Tiefe arbeiten. Hier macht eventuell der Einsatz eines Differenzdruckreglers Sinn. Das jedoch ist ein Thema für sich, in das es sich lohnt, genauer hineinzuschauen. Um es in einem Satz zusammenzufassen: Wir unterteilen ein großes Rohrnetz in mehrere kleine. Diesen Vorgang nennt man Zonieren.
- Welcher Verbraucher ist an das System eingebunden? Handelt es sich um eine Fußbodenheizung oder etwa um Heizkörper oder Heizlüfter? Wie genau Sie beispielsweise bei einer Fußbodenheizung vorgehen und wie Sie diese hydraulisch abgleichen, finden Sie in unserem Artikel zu diesem Thema: Optimierung der Fußbodenheizung durch hydraulischen Abgleich.
- Wie wird der Verbraucher mit Wärme versorgt? Eventuell handelt es sich bei Ihrem System ja um eine Einrohrheizung. Was tun? Die Lösung hierbei sind Strangregulierventile. Weg vom Gedanken der Einregulierung einzelner Heizkörper – die Gefahr, dass das hydraulische System durch eine Überregulierung aus dem Gleichgewicht gebracht wird, ist schlichtweg zu groß.
- Welche Thermostatventile wurden verbaut? Handelt es sich um statische oder dynamische Thermostatventile? Während man sich ein statisches Thermostatventil wie einen Wasserhahn vorstellen kann – einmal eingestellt, bleibt die Öffnung gleich und ist daher druckabhängig –, wird bei einem dynamischen Ventil, das druckunabhängig ist, der Durchfluss eingestellt. Diese Ventile sind druckunabhängig und brauchen eigentlich nur eine konstante Druckdifferenz. Damit ist selbst bei einem Teillastbetrieb der richtige Durchfluss gewährleistet.